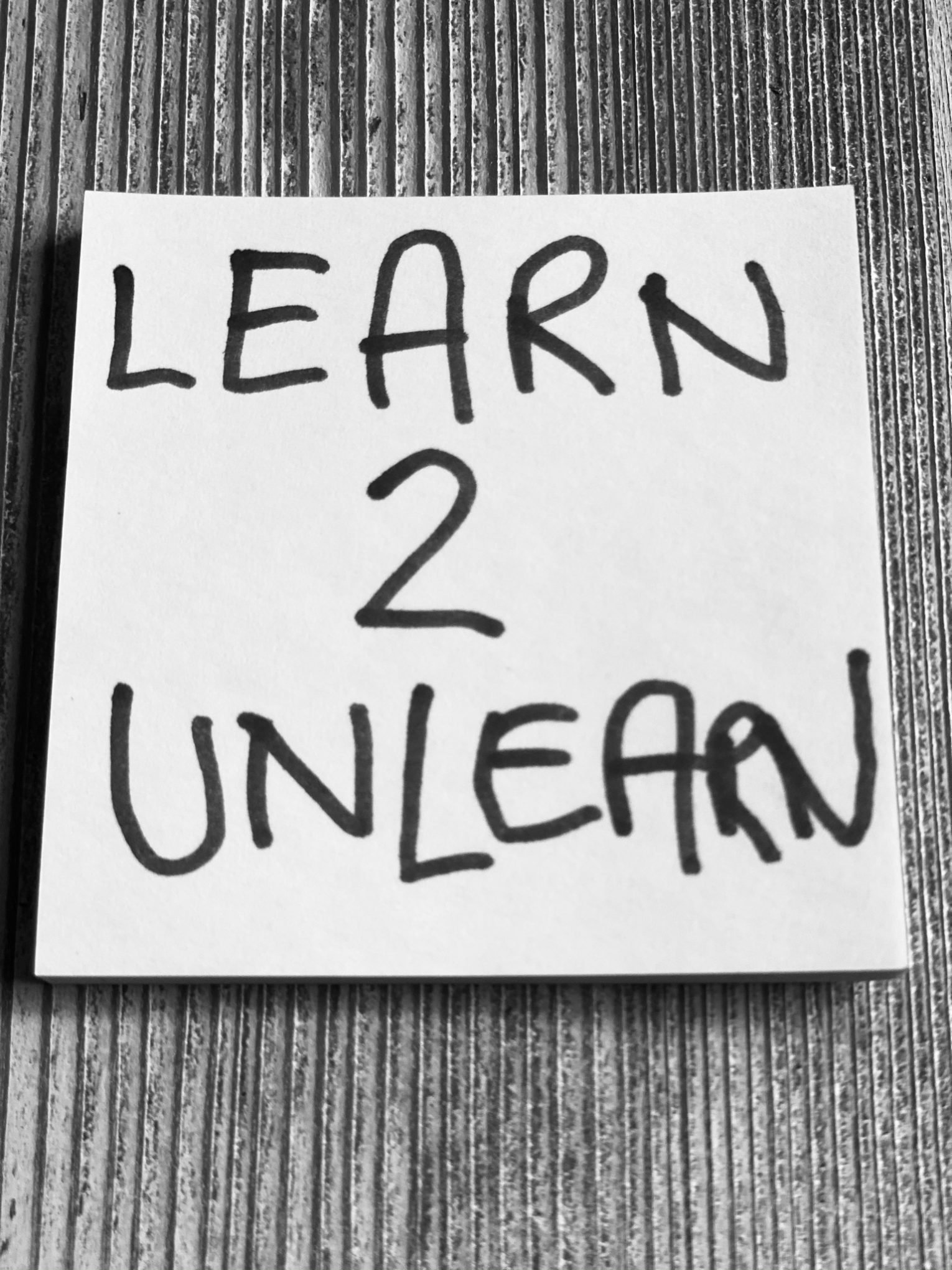Welche Rolle spielt die Kunstvermittlung im Umgang mit dem kolonialen Erbe? In welchem Verhältnis stehen die Sammlungen aus den einstigen Kolonien zu aktuellen Vermittlungsformaten? Wie lässt sich das museale Sammeln und Kategorisieren mit partizipativen Impulsen vereinen? Ausgehend von diesen Fragen bespreche ich das Potential der postkolonialen Theorien für eine zeitgenössische und kritische Kunst- und Kulturvermittlung, die durch dekonstruktive und transformative Ansätze Möglichkeiten zur nachhaltigen Veränderung bietet.
Nora Sternfeld beschreibt das Museum als „öffentliche Institution, die mit der Straße als Raum des Protests und dem Parlament als Versammlungsraum verbunden ist, aber anders kann und macht.“[1] Diese Definition bezeichnet einen ambivalenten Ort, der einerseits widerständiges Potential in sich trägt und so zur gesellschaftlichen Veränderung auffordert, aber andererseits auch eine historisch gewachsene Institution ist, die wertvolle Informationen sammelt und diskursive Auseinandersetzungen unterstützt. Sternfelds Nebensatz, dass das Museum aber keinen dieser Ansprüche erfüllt, macht es zu einem Zwischenraum oder Dritten Raum nach Homi Bhabha, der weder das eine, noch das andere ist, sondern sich hybrid dazwischen bewegt und deren Gegensätze in sich versöhnt.[2] Seit dem sog. „reflexive turn“ untersucht das Museum seine eigenen Strukturen und versucht sich an einer Dekonstruktion seiner Kernaufgaben, die auch die Vermittlungsaufgabe einschließt.[3]
An einer anderen Stelle skizziert Sternfeld den Aufgabenbereich der Kunstvermittlung, in dessen Zentrum die Auseinandersetzung mit künstlerischen Produktionen steht. Das Tätigkeitsfeld umfasst dabei Information, Kommunikation und Partizipation. Das zeitgenössische Museum strebt eine Veränderung der Ausstellungssituation hin zu einer Kontaktzone an, wobei die kritische Position gegenüber dem Ausgestellten institutionell verankert ist. Die Aufgabe der Kunstvermittlung ist es, auf dieses Kritikpotential aufmerksam zu machen. Dabei bewegt sie sich zwischen zwei Pole: Einerseits ist die Kunstvermittlung „angepasst“, da sie auf eine Institution angewiesen ist, mit der sie arbeitet und die sie bedingt: ohne das Museum – keine Kunstvermittlung (in dieser Form). Andererseits ist die Kunstvermittlung nach Sternfeld auch „unangepasst“, weil sie zu kritische Fragestellungen auf Werke aufmerksam macht und einen kritischen Diskurs anregt. Diese Kritik ist institutionell bedingt und zählt zum Bildungsauftrag der zeitgenössischen Museologie.[4]Daran schließen Fragestellungen der Institutionskritik an. Andrea Fraser zweifelt an der Existenz des Museums nicht, sondern diskutiert Werte, Praktika und Ziele, um es so zu einem „Ort der Kritik“ zu transformieren.[5]
Diese Entwicklungen beschreiben eine Transformation, die mit der Methode des Verlernens zusammenzufassen ist. Diese fragt nach dem Raum der Artikulationsfähigkeit von Stimmen, die nicht mit der Institution assoziiert sind und verhandelt deren Potential zu einer institutionellen Veränderung.[6] „Verlernen“ beschreibt nicht das Ignorieren oder Vergessen des bestehenden Wissens, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit dem Gelernten: Das Verlernen hinterfragt, unter welchen sozio-politischen Umständen und unter welchen kulturellen Einflüssen der Wissenskanon gebildet wurde. Diese Untersuchung ermittelt Positionen von Sprecher*innen, die in hegemoniale Machtstrukturen verankert sind. Es ist die Aufgabe der kritischen Kunstvermittlung auf diese Positionen zu verweisen und sie zur Diskussion zu stellen. Dadurch öffnet sich ein partizipativer Raum des Austausches mit dem Publikum, das einen Dialog eröffnet und neue Impulse zulässt. Das gelernte Wissen wird abgefragt und durch Verlernen kritisch eingeordnet, um so neues Wissen zu generieren. Die Diskussionsfähigkeit öffnet ein Feld, um über Möglichkeiten zu sprechen, die einen inklusiveren Zugang zu Kunst und Kultur verfolgen. Eine postkoloniale Kunstvermittlung informiert beispielsweise nicht nur über die europäischen Eroberungsfahrten, sondern stellt einen Bezug zur Gegenwart her und fragt nach der zeitgenössischen und künstlerischen Repräsentanz fremder Kulturen.
Es gibt Parallelen zwischen dem Verlernen und Jurij Lotmanns Konzept der Semiosphäre. In Die Innenwelt des Denkens entwirft er einen semiotischen Raum, in dem Zentrum und Peripherie in intensivem Austausch stehen. Im Zentrum steht nach Lotmann „die natürliche Sprache der jeweiligen Kultur“.[7] Damit sind komplexe kulturelle Prozesse gemeint, die Normen und Vorschriften hervorbringen, um so ein Ideal oder einen Kanon zu formen. Alles, was diesem nicht entspricht, ist nach Lotmann Teil der Peripherie. Beide Räume gelten sowohl als ausschließend sowie als konstruktiv.[8] Die Praktiken des Zentrums gelten allerdings nicht für die Peripherie, da diese einer anderen Organisation und Struktur unterliegt. Steht eine westlich geprägte Kultur im Museum im Vordergrund, braucht die kritische Kunstvermittlung neue Formate, wenn sie postkoloniale Bestreben verfolgt. Da Kulturen der Peripherie nicht nach denselben Mustern wie jene des Zentrums „funktionieren“, werden diese in ihren Besonderheiten ignoriert.
Durch eine aktive Hinwendung zur Peripherie und einer kritischen Beschäftigung mit dem Zentrum verändert sich das Verhältnis zwischen den beiden Polen. Der Kanon verliert so an primärer Bedeutung und andere Herangehensweisen werden intensiver betrachtet. Die Sprache oder Kultur der Peripherie wird durch intensive Auseinandersetzung zum Zentrum und es erfolgt eine Bedeutungsverschiebung, die Auswirkungen auf die Kultur des ursprünglichen Zentrums hat. Sie überschreitet eine filternde Grenze und wird Teil des inneren Raumes.[9]
In Bezug auf die Museumsarbeit bzw. der Methode des Verlernens bedeutet das, dass tradierte Vermittlungsformate von neuen Programmen abgelöst werden. Während bei einer affirmativen und reproduktiven Ausstellungsführung die Rollen zwischen der Vermittlungsperson und dem Publikum durch eine klare Grenze definiert sind, ermöglicht die Methode des Verlernens, so möchte ich argumentieren, eine Verschiebung, sodass subkulturelle Einflüsse und postkoloniale Auslegungen stärker an Bedeutung gewinnen. Partizipative Auseinandersetzungen werden ins Zentrum erhoben und stehen neben affirmativen und reproduktiven Formate, die sie nach Lotmanns Theorie nicht verdrängen. Die Methode des Verlernens ist kein destruktives Verfahren, sondern eines, das feste Strukturen hybridisiert und kritisch diskutiert.
Obwohl Sternfeld in ihren Texten durchaus einen „reflexive turn“ unterstützt, betont sie auch, dass es nicht reicht, nur die eigene Perspektive zu hinterfragen, da sich das Museum dann erst recht mit sich selbst beschäftigt, anstatt sich für Gegenerzählungen zu öffnen.[10] Damit einher geht das neoliberale Bestreben, neue und andere Bevölkerungsstrukturen ans Museum zu binden. In einem anderen Aufsatz schreibt sie, von den Möglichkeiten und Grenzen der Selbstermächtigung, wenn es darum geht, auch marginalisierten Gruppen den Weg ins Museum zu weisen. Nach Sternfeld ist die eigentliche Schwierigkeit im Audiance Development nicht die Entwicklung neuer Formate, sondern die fundamentalere Frage, welche Informationen überhaupt vermittelt werden. Mit der Auswahl von Kontexten und Fragen sind immer auch Ausschlussmechanismen verbunden. Letztendlich soll eine kritische Kunstvermittlung aber auch genau dieses Ungleichgewicht aufzeigen und so Unterdrückungs- und Machtverhältnisse in der Bildung eines Kanons bzw. in weiterer Folge in der Tradierung von kulturellen Werten bzw. gesellschaftlichen Normen ans Licht bringen. Die große Herausforderung liegt also darin, nicht nur die kuratorischen Entscheidungen offenzulegen oder die eigene Position als Sprecher*in zu thematisieren, sondern auch die Rolle des/r Besucher*in zu diskutieren. Sternfeld erklärt die tradierten Vermittlungsformen mit einer Taxi-Metapher, wobei es darum geht, das Publikum von einem Ort („Zustand des Nicht-Wissens“) zu einem anderen Ort („Zustand des Wissens“) zu transferieren. Mit der aktiven Eingliederung des Publikums ins Vermittlungsformat:[11]
würde die Frage verhandelt werden, „wer“ aus „welcher Perspektive“ „was“ sieht, was dabei nicht in den Blick geraten kann und mit welchen gesellschaftlichen Vorstellungen, Macht- und SprecherInnenpositionen die Bilder, die sie haben (und die wir auch selbst haben), in Verbindung stehen.[12]
Anstatt marginalisierte museumsfremde Bevölkerungsgruppen zu belehren, gilt es, deren Position zu kontextualisieren und ein Bewusstsein für ihre Lage, die an gesellschaftliche und strukturelle Bedingungen geknüpft ist, zu schaffen. Durch aktives Fragen nach den jeweiligen Perspektiven verliert auch die kuratorische Inszenierung an Bedeutung. Gegenerzählungen im Sinne eines Re-writing of history oder Re-telling of history stehen dann neben den überlieferten Formen der Wissenstradierung. Es liegt dann in der Verantwortung der Institutionen, diese Gegenerzählungen auch aktiv ins Museum aufzunehmen,[13] sodass es keine Unterschiede bezüglich der Materialität der Wissensformen gibt. Die in Ausstellungen fixierte Texte sind den mündlich erzählten Narrativen hierarchisch übergeordnet – ein Ungleichgewicht, das sich die Ausstellungspraxis zu widmen hat. Es geht nicht nur darum, den Raum für Gegenerzählungen zu schaffen, marginalisierten Gruppen die Möglichkeit zu sprechen zu geben, sondern den Kanon durch diese Geschichten zu erweitern. Nach Elke Zobl müssen verschiedene Wissensformen – der akademische Kanon sowie Erfahrungswissen – als gleichwertig betrachtet werden.[14] Erst dann können jene Stimmen tatsächlich gehört werden – um mit Gayatri Spivaks Jargon zu sprechen.[15]
*
Es ist nun Zeit zu fragen, wie sich diese theoretischen Überlegungen in der Praxis umsetzen lassen: Wie kann in einem zeitlich begrenzten Rahmen tatsächlich Verlernen stattfinden? Wie können in nur wenigen Stunden sämtliche gesellschaftliche Strukturen aufgegriffen und trotzdem genug Zeit gefunden werden, um über künstlerische und ästhetische Inhalte zu sprechen? Mithilfe des Konzepts Talking Back von bell hooks möchte ich mich einer Antwort nähern:
In the world of southern black community I grew up in „back talk“ and „talking back“ meant speaking as an equal to an authority figure. It meant daring to disagree and sometimes it meant having an opinion.[16]
Talking Back ist als Gegenentwurf zu Spivaks Aufsatz zu verstehen, in dem sie argumentiert, dass marginalisierte Stimmen nicht gehört werden. Talking Back geht davon aus, dass die eigene Meinung gleichwertig wie jene der Autorität zählt. Nach bell hooks handelt es sich um eine individuelle Stimme, die eine Person und ihre Identität ausmacht. Dennoch sind das Sprechen und Schweigen unterschiedlichen gesellschaftlichen Konventionen und Handlungsräumen unterlegen. bell hooks sieht das „wahre“ Sprechen als Akt des Widerstands sowie als politischer Ausdruck, der die machtstrukturellen Verhältnisse herausfordert. Letztere würden dazu beitragen, bestimmten Gruppen das Sprechen zu untersagen. Aus diesem Grund ist das Sprechen auch ein Wagnis, sich gegen dominierende Praktiken aufzulehnen. bell hooks schließt:[17]
Moving from silence into speech is for the oppressed, the colonized, the exploited, and those who stand and struggle side by side, a gesture of defiance that heals, that makes new life, and new growth possible. It is that act of speech, of „talking back“ that is no mere gesture of empty words, that is the expression of moving from object to subject, that is the liberated voice.[18]
Talking Back ist eine dekonstruktive Methode, um sich Gehör zu verschaffen, um sich von tradierten unterdrückenden Strukturen zu befreien, um vom Objekt zum Subjekt zu transformieren. Das Subjekt-Objekt-Verhältnis ist auch für die Museumsarbeit zentral und kommt dann zum Tragen, wenn es beispielsweise um das Ausstellen von Kunst eines Mitgliedes einer indigenen Kultur geht. Nicht nur die Kunst selbst, sondern auch die Kunstschaffenden werden zum Objekt, wenn ihnen eine Erklärung aus westlicher Perspektive aufoktroyiert wird. Die westliche Ausstellungssituation widersagt der Kunst die Sprechfähigkeit. Talking Back greift in diese Ungleichheit ein: Einerseits kann das, wie oben beschrieben, im Sinne eines „reflexive turn“ passieren, indem die Ausstellungskonzeption selbst so ausgelegt ist, dass Kunst kulturell inkludierend und kontextualisiert wird – in der Gesellschaft und im Museum. Andererseits kann Talking Back auch ein partizipatives Vermittlungsformat meinen. Dabei nehmen Besucher*innen Stellung zu ihrer Situation als Publikum und zur ausgestellten Kunst. Divergierende Positionen werden dabei nicht als störend empfunden, sondern als bereichernd in die Ausstellungssituation eingearbeitet. Fragen werden demnach nicht an die/den Expert*in gestellt, sondern an das Publikum. Assoziationen und Blickrichtungen der Besucher*innen stehen so neben jenen der Institution, wobei letztere nicht dominieren. Talking Back meint schließlich auch, das „Wagnis“ zu widersprechen und Widerstand gegen tradierte Wissensformen der Kunstgeschichte wie der christlichen Ikonografie oder Ikonologie zu leisten. Selbst die klassischen Werke der Kunstgeschichte, über die es bereits viele Forschungsarbeiten und Interpretationen gibt, können im Talking Back eine Revision ihrer Bedeutung erfahren. Indem sich marginalisierte Gruppen mit der ausgestellten Kunst auseinandersetzen, generieren sie nicht nur Gegenerzählungen, sondern decken vermeintlich verstecktes Potential und bisher wenig beachtete Perspektiven sowie Interpretationen auf.
*
Talking Back hat enge Beziehungspunkte zur Methode des Verlernens. Beide Konzepte können sowohl von Seite der Institution als auch von Seite des Publikums gelesen werden und orientieren sich nicht nur an einem „reflexive turn“, sondern auch an einen breiteren gesellschaftlichen Rahmen: Subalternen oder subkulturellen Gruppen wird der Raum zum Sprechen gegeben, der über die Ästhetik hinausgeht und sie in ihrer unterdrückten Situation ernstnimmt. Es ist aber auch von großer Bedeutung, dass sich Talking Back nicht nur auf eine temporäre Erzählung beschränkt, sondern diese institutionell festgehalten und dauerhaft fixiert wird, um den Kreislauf des Ausschlusses nicht zu wiederholen.
Es ist an dieser Stelle einzuräumen, dass die Umsetzung einer solchen Museumspraxis zweifelsohne viele Herausforderungen mit sich bringt. Gemeinsam mit der Öffnung zu partizipativen Formen braucht es ein Bewusstsein, um Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen tatsächlich fürs Museum und seine Diskurse zu interessieren. Das hat die Folge, dass sich grundlegende Strukturen aber auch Verhaltensregeln weitgehend ändern müssen.
Obwohl es bis zur Durchsetzung des postkolonialen Museums auf allen Ebenen noch viel Arbeit bedarf, sind bereits wichtige Überlegungen getan, die einen solchen Umbruch herbeiführen können. Schließlich liegt es an den einzelnen Museen und Institutionen, wie sie welchen Werte Raum zusprechen und wie sie mit der Verantwortung umgehen, die die postkolonialen Forderungen an sie stellen. Dieses Anliegen sei mit Worten des kamerunischen Philosophen Fabien Eboussi Boulaga beschlossen, der in Anlehnung an Hegel folgendes Bestreben formuliert:
Daher ist der einzige Weg zur Freiheit wahrscheinlich, gemeinsam frei zu sein, der Herr und der Knecht zur selben Zeit.[19]
Magdalena Mühlböck studierte Germanistik und Komparatistik an der Universität Salzburg. Derzeit arbeitet sie an ihrer Dissertation zum Thema Europäisches Wissen über die außereuropäische Welt.
Literaturverzeichnis
Bhabha, Homi: How Newness Enters The World. Postmodern Space, Postcolonial Time and the Trials of Cultural Translation. In: The Location of Culture. London/New York: Routledge 2004, S. 303-337.
Eboussi Boulaga, Fabien: Wenn wir den Begriff „Entwicklung“ akzeptieren, sind wir verloren. Von der Notwendigkeit einer gegenseitigen „Dekolonisierung“ unseres Denkens. In: Franziska Dübgen, Stefan Skupien (Hg.): Afrikanische politische Philosophie. Postkoloniale Positionen. Berlin: Suhrkamp 2015, S. 115-126.
hooks, bell: Talking Back In: Discourse (1986), H. 8, S. 123-128.
Lotmann: Die Innenwelt des Denkens. Eine semiotische Theorie der Kultur. Berlin: Suhrkamp 2010.
Mörsch, Carmen: Allianzen zum Verlernen von Privilegien. Plädoyer für eine Zusammenarbeit zwischen kritischer Kunstvermittlung und Kunstinstitutionen der Kritik. In: Nanna Lüth, Sabine Himmelsbach (Hg.): Medien Kunst Vermitteln. Berlin: Edith-Ruß-Haus für Medienkunst und Revolver 2011, S. 11-26.
Spivak, Gayatri: Can the Subatlern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation. Wien: Turia + Kant 2008.
Sternfeld: Der Taxisspielertrick. Vermittlung zwischen Selbstregulierung und Selbstermächtigung. In: Beatrice Jaschke, Charlotte Martinz-Turek, Nora Sternfeld (Hg.): Wer spricht? Autorität und Autorschaft in Ausstellungen. Wien: Turia + Kant 2005, 2005, S. 15-33.
Sternfeld: Einleitung. In: Dies. (Hg.): Das radikaldemokratische Museum. Berlin/Boston: De Gruyter 2018, S. 11-51.
Sternfeld, Nora: Das Museum deprovinzialisieren. Was wäre ein Museum, wenn es ein westliches Konzept wäre? In: Dies. (Hg.): Das radikaldemokratische Museum. Berlin/Boston: De Gruyter 2018, S. 85-94.
Sternfeld, Nora: Wo steht die Vermittlung? Eine Einführung, die ihrer Skepsis begegnet. In: Dies. (Hg.): Das radikaldemokratische Museum. Berlin/Boston: De Gruyter 2018, S. 147-157.
Zobl, Elke: Perspektivenwechsel gefragt. Hin zu einer selbstreflexiven und kritischen kulturellen Teilhabe. In: p/art/icipate (2018), S. 1-15.
[1] Sternfeld: Einleitung. In: Dies. (Hg.): Das radikaldemokratische Museum. Berlin/Boston: De Gruyter 2018, S. 21
[2] Bhabha, Homi: How Newness Enters The World. Postmodern Space, Postcolonial Time and the Trials of Cultural Translation. In: The Location of Culture. London/New York: Routledge 2004, S. 310-311, 321.
[3] Vgl. Sternfeld: Einleitung 2018, S. 22, 37.
[4] Vgl. Sternfeld, Nora: Wo steht die Vermittlung? Eine Einführung, die ihrer Skepsis begegnet. In: Dies. (Hg.): Das radikaldemokratische Museum 2018, S. 147-151.
[5] Vgl. Mörsch, Carmen: Allianzen zum Verlernen von Privilegien. Plädoyer für eine Zusammenarbeit zwischen kritischer Kunstvermittlung und Kunstinstitutionen der Kritik. In: Nanna Lüth, Sabine Himmelsbach (Hg.): Medien Kunst Vermittlen. Berlin: Edith-Ruß-Haus für Medienkunst und Revolver 2011, S. 20.
[6] Vgl. Zobl, Elke: Perspektivenwechsel gefragt. Hin zu einer selbstreflexiven und kritischen kulturellen Teilhabe. In: p/art/icipate (2018), S. 6.
[7] Lotmann: Die Innenwelt des Denkens. Eine semiotische Theorie der Kultur. Berlin: Suhrkamp 2010, S. 169.
[8] Vgl. Ebd., S. 169-172.
[9] Vgl. Ebd., S. 174-178, 182, 184.
[10] Vgl. Sternfeld, Nora: Das Museum deprovinzialisieren. Was wäre ein Museum, wenn es ein westliches Konzept wäre? In: Dies. (Hg.): Das radikaldemokratische Museum 2018, S. 90.
[11] Vgl. Sternfeld: Der Taxisspielertrick. Vermittlung zwischen Selbstregulierung und Selbstermächtigung. In: Beatrice Jaschke, Charlotte Martinz-Turek, Nora Sternfeld (Hg.): Wer spricht? Autorität und Autorschaft in Ausstellungen. Wien: Turia + Kant 2005, 2005, S. 30-31.
[12] Ebd., S. 31.
[13] Vgl. Ebd., S. 31-32.
[14] Vgl. Zobl: Perspektivenwechsel gefragt 2018, S. 8.
[15] Spivak, Gayatri: Can the Subatlern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation. Wien: Turia + Kant 2008, S. 106.
[16] bell hooks: Talking Back In: Discourse (1986), H. 8, S. 123.
[17] Vgl. Ebd., S. 123, 126-127
[18] Ebd., S. 128.
[19] Eboussi Boulaga, Fabien: Wenn wir den Begriff „Entwicklung“ akzeptieren, sind wir verloren. Von der Notwendigkeit einer gegenseitigen „Dekolonisierung“ unseres Denkens. In: Franziska Dübgen, Stefan Skupien (Hg.): Afrikanische politische Philosophie. Postkoloniale Positionen. Berlin: Suhrkamp 2015, S. 117.